Die berühmte Sentenz / Formel zur Rettung und Einheit der Menschheit in der nachkanonischen Literatur des Judentums und im Koran
Von Friedrich Erich Dobberahn
Jerusalemer Talmud, Sanhedrin IV, 9
.
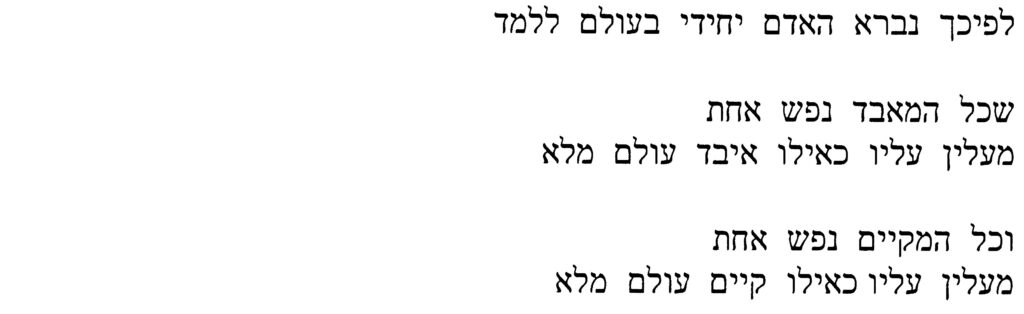
Lefīḵāḵ niḇrā’ hā-’āḏām yeḥīḏī ḇā‘ōlām le-lammeḏ
šäk-kål ha-me’abbēḏ näfäš ’aḥaṯ
ma‘alīn ‘ālāyw ke-’illū ’ībbēḏ ‘ōlām mālē’,
weḵål ham-meqayyēm näfäš ’aḥaṯ
ma‘alīn ‘ālāyw ke-’illū qiyyēm ‘ōlām mālē’.
.
Deshalb ist nur ein einziger Mensch erschaffen worden, um dich zu lehren,
dass: Wer auch immer eine Person vernichtet,
es ihm angerechnet wird, als hätte er eine ganze Welt vernichtet,
und [dass]: Wer auch immer eine Person erhält,
es ihm angerechnet wird, als hätte er eine ganze Welt erhalten.
.
Babylonischer Talmud, Sanhedrin IV, 5 (f. 37a)
.
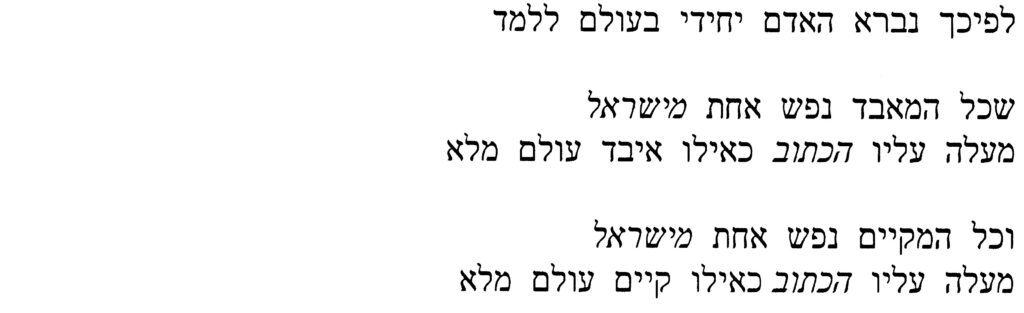
Lefīḵāḵ niḇrā’ hā-’āḏām yeḥīḏī ḇā‘ōlām le-lammeḏ
šäk-kål ha-me’abbēḏ näfäš ’aḥaṯ miy-yiśrā’ēl
ma‘aläh ‘ālāyw hak-kāṯūb ke-’illū ’ībbēḏ ‘ōlām mālē’,
weḵål ham-meqayyēm näfäš ’aḥaṯ miy-yiśrā’ēl
ma‘aläh ‘ālāyw hak-kāṯūb ke-’illū qiyyēm ‘ōlām mālē’.
.
Deshalb ist nur ein einziger Mensch erschaffen worden, um dich zu lehren,
dass: Wer auch immer eine Person von Israel vernichtet,
es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er eine ganze Welt vernichtet,
und [dass]: Wer auch immer eine Person von Israel erhält,
es ihm die Schrift anrechnet, als hätte er eine ganze Welt erhalten.
.
Kommentar I:
1) Bei der genaueren Analyse dieser weltberühmten Sentenz / Formel, die in der Überschrift nach dem Wortlaut aus dem Film „Schindlers Liste“ (USA 1993, Steven Spielberg) zitiert wird, muss man sich zunächst vergegenwärtigen, dass auch diese Sentenz in der Spätantike mehrfach umlief, bisweilen ihre Struktur veränderte und in verschiedene Kontexte eingebettet wurde. Die Varianten in der Mischna, im Jerusalemer Talmud, im Babylonischen Talmud und an anderen Stellen wie im Koran und in 1001 Nacht, zeigen das. Hier nur ein Beispiel: Bei den von Emanuel bin Gorion gesammelten „Geschichten aus dem Talmud“, S. 317 f. 498, findet sich die Sentenz in der Erzählung „Der gerechte Benjamin“ (Baba Batra, f. 11a). Dort gibt sie ihre Doppelstruktur auf, wird nur mit der zweiten Hälfte zitiert und enthält den Zusatz „von Israel“. Der Hinweis auf die Schrift wird durch die Formulierung ersetzt, dass „der Herr der Welt“ gesprochen habe:
„Herr der Welt! Du hast gesprochen, daß, wer nur eine Seele miy-yiśrā’ēl = von Israel erhält, einem gleiche, der die ganze Welt erhält“.
2) Der erste, ins Auge fallende Unterschied in der Formulierung der Formel zwischen dem Jerusalemer Talmud (4.-5. Jh. n. Chr.; zit. n. Heinrich W. Guggenheimer, Jerusalem Talmud, S. 165), sowie einigen Handschriften und anderen Zeugnissen, besteht zum Babylonischen Talmud (kodifiziert im 6. Jh. n. Chr.) darin, dass letzterer – wie oben beim Text des Babylonischen Talmuds mit wechselndem Schrifttyp gezeigt – zwei Mal den Zusatz macht: „מישראל = miy-yiśrā’ēl = [eine Person] von Israel“. Weil der in der Sentenz genannte „erste Mensch“ kein Israelit sein konnte (so Mischnajot, S. 161 mit Anm. 43), hört sich der Zusatz wie eine nachträgliche Einschränkung der Universalität der Formel an, so als ob das ethische „Tötungsverbot“ nur innerhalb der Solidargemeinschaft Israels Geltung besitzen sollte. Auch wenn die politische und soziale Stellung der „Perserjuden“ in allen Schichten des Achämenidenreiches bei weitem nicht der bedrohlichen Situation der Israeliten vor dem Exodus aus Ägypten entsprach (vgl. Esther 3, 8-15; Gillis Gerleman, Esther, S. 27 f), kann der Zusatz „von Israel“ durch die oft beschriebene Gefährdung der jüdischen Diasporagemeinschaft (vgl. z.B. die Vollversion des Chanukka-Liedes nach Raphael Jacob Fürstenthal, Israels Gebete, S. 583-587) bedingt sein. Man hätte auf diesem Wege die Einhaltung der Formel der Diasporagemeinde bloß dringend angemahnt, ohne hier im Widerspruch zur universellen Ausrichtung die Gültigkeit der Formel nur auf „Israel“ festzulegen (vgl. a. Muhammad Asad, Die Botschaft des Koran, S. 204, Anm. 40).
Der zweite Unterschied besteht in dem Hinweis auf die Schrift: „… es ihm הכתוב = hak-kāṯūb die Schrift anrechnet.“ Mit diesem ebenso wiederholten Zusatz soll – wie im Folgenden dargelegt – durch den Rückgriff auf die Torah die ursprünglich rein mündliche Tradition der nachkanonischen Überlieferung von Mischna bis Talmud als schriftgemäß ausgegeben werden. Diese Zusätze sind gemäß der textkritischen Regel lectio brevior lectio probabiliter [die kürzere Lesart ist wahrscheinlich die ursprüngliche] leicht als sekundäre redaktionelle Eingriffe zu erkennen.
3) Wenn wir nun nach dem vermutlichen Ursprung der universalen Tendenz dieser Formel fragen, stoßen wir auf die Tatsache, dass diese sowohl in der Mischna, als auch im Jerusalemer und Babylonischen Talmud (vgl. im Koran, Sure 5, 27-31) aus der Geschichte des Brudermordes (Genesis 4, 3-16, Kain und Abel) hergeleitet wird. In der Mischna, sowie in den beiden Talmudim erscheint in der Formulierung „das Blut deines Bruders [Abel]“ das Wort „Blut“ – wie auch schon in der Torah (Gen. 4. 10 f) – im Plural (דמי = demē; s. Otto Eissfeldt, Liber Genesis, S. 6). Die Mischna (3. Jh. n. Chr.) und die beiden Talmudim legen den Plural (דמי = demē) nun als das „mehrfache Blut [Abels]“ aus: als das Blut seiner Nachkommen (Mischnajot, S. 161 mit Anm. 39; Heinrich Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, S. 88). D.h.: Es ist also schon in der Torah nicht nur an das Blut eines einzelnen Menschen wie Abel gedacht, sondern zugleich an das Blut aller möglichen Nachkommen desselben. Der Ursprung der universellen Ausrichtung der Sentenz / Formel dürfte also tatsächlich hier, im pluralischen Verständnis des Blutbegriffs liegen: Wenn jemand einen Menschen erschlägt, so erschlägt er damit auch alle dessen Nachkommen. Mit dem einen Totschlag eines Menschen wird zugleich eine ganze Sippe ausgelöscht. Konsequent weitergedacht ließ sich dann die „Sippe“, der „Stamm“, „das Volk“ zum Symbol für eine ganze „Welt“ (מלא עולם = ‘ōlām mālē’) ausweiten und steigern: „… als hätte er eine ganze Welt vernichtet.“ Dasselbe dann auch in positiver Gegenwendung hierzu: Erhält jemand ein Leben, dann ist es schließlich so, „als hätte er eine ganze Welt erhalten.“
______
Koran, Sure 5, 32
.
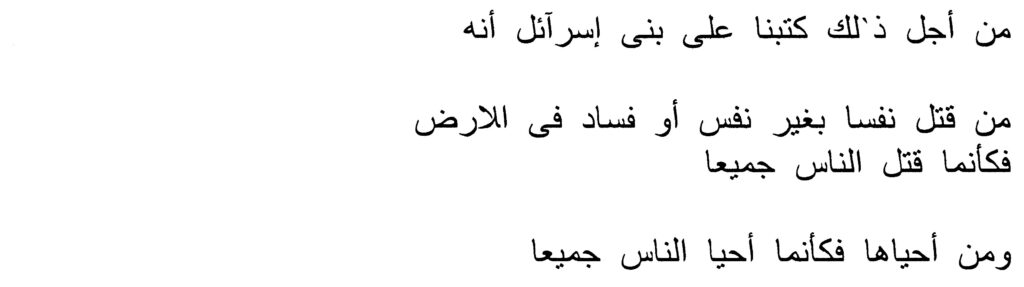
min ’aǧli ḏālika katabnā ‘alāy banī ’isrā’īla, ’annahū
man qatala nafsan bi-ġayri nafsin ’aw fasādin fī l-’arḍi
fa-ka-’annamā qatala n-nāsa ǧamī’an
wa-man ’aḥyāhā fa-ka-’annamā ’aḥyā n-nāsa ğamī‘an.
Übersetzung nach Hartmut Bobzin, Der Koran, S. 97:
„Und deshalb schrieben wir den Kindern Israel dies vor:
Wenn jemand einen Menschen tötet, der keinen anderen getötet,
auch sonst kein Unheil auf Erden gestiftet hat,
so ist’s, als töte er die Menschen allesamt.
Wenn aber jemand einem Menschen das Leben bewahrt,
so ist’s, als würde er das Leben aller Menschen bewahren.“
Kommentar II:
1) In Hinsicht auf die Zeilen 2-3 gilt es zunächst, mit Hartmut Bobzin, Der Koran, S. 645, genau auf die Definitionen und rechtlichen Implikationen der hier verwendeten Terminologie zu achten:
bi-ġayri nafsin: wörtlich: „[der] nicht für eine Seele [getötet hat]“, d.h. der nicht als erlaubte Vergeltung dafür getötet hat, dass jemand umgebracht wurde, „im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (vgl. Sure 2, 178 f.194 und 5, 45).
fasādin: Unheil, Verderbnis („corruptio“, Georg Wilhelm Freytag, Lexicon Arabico-Latinum, III, S. 347a); hier ist eine Untat gemeint, deren Sühnung auch die Tötung eines Menschen rechtfertigt (vgl. Sure 5, 33).
Im Unterschied zur jüdischen Tradition der Sentenz wird damit im Koran ein ausdrücklicher Vorbehalt zugunsten des Rechtsgrunds der Tötung bei Blutrache oder der Tötung als Bestrafung für schwere Verbrechen (vgl. Sure 25, 68) in die Formel eingeschoben, wie das am deutlichsten in der Übersetzung von Muhammad Asad, Die Botschaft des Koran, S. 204, zum Ausdruck kommt:
„Deswegen haben Wir für die Kinder Israels verordnet, daß, wenn irgendeiner einen Menschen tötet – es sei denn (als Strafe) für Mord oder für Verbreiten von Verderbnis auf Erden – , es sein soll, als ob er alle Menschheit getötet hätte.“
Alternative, ähnlich sinnwahrende Übersetzungen lauten:
„[…] Wenn jemand einen Menschen erschlägt, ohne einen anderen Menschen (zu rächen) oder [ohne] daß Unheil auf Erden ist, so sei es, als habe er alle Menschen erschlagen.“ Lazarus Goldschmidt, El Koran, S. 102.
„[…], daß, wer einen umbringt, nicht um zu vergelten oder weil dieser Verderben auf Erden anrichtete (aus Vergeltung oder im Krieg), es so sei, als habe er alle Menschen umgebracht.“ Ludwig Ullmann, Der Koran, S. 94.
„[…], daß, wenn einer jemanden tötet (und zwar) nicht (etwa zur Rache) für jemand (anderes, der von diesem getötet worden ist) oder (zur Strafe für) Unheil (das er) auf der Erde (angerichtet hat), es so sein soll, als ob er die Menschen alle getötet hätte.“ Rudi Paret, Der Koran, S. 82; vgl. a. Ders., Kommentar und Konkordanz, S. 120.
„[…] Wenn einer jemanden tötet, jedoch nicht wegen eines Mordes oder weil er auf der Erde Unheil stiftet, so ist es (oder: so soll es sein, als …: und zwar im Hinblick auf die Bestrafung), als hätte er die Menschen alle getötet.“ Adel Theodor Khoury / Muhammad Salim Abdullah, Der Koran, S. 83.
„[…] Wer jemanden tötet, ohne daß dieser eine Blutschuld auf sich geladen (wörtlich: wer jemanden/eine Seele ohne den Gegenwert eines anderen/einer anderen Seele tötet) oder Unheil auf Erden gestiftet hätte (vgl. Sure 5, 33; 18, 74), der tötet gleichsam alle Leute.“ Tilman Nagel, Mohammed – Leben und Legende, S. 942 f; vgl. ebd., S. 463.
2) Nach Tilman Nagel, ebd., S. 463.942-944, hat der Koran aus der jüdischen Tradition die zweiteilige Sentenz / Formel deshalb aufgegriffen, um innerhalb der eigenen Solidargemeinschaft bei versehentlichen Tötungsvergehen und durch Schulderlassung zum Verzicht auf das Recht zur Blutrache aufzurufen. Die in Sure 5, 32 eingebrachte Sentenz solle vor allem bei Sachlage der Unabsichtlichkeit (Sure 4, 92 f), aber auch durch Schulderlassung (Sure 2, 148) die Mitglieder der „gläubigen“ Solidargemeinschaft vor vergeltenden Maßnahmen, die von ihresgleichen ausgehen könnten, schützen. Das Blühen und Wachstum der eigenen Solidargemeinschaft (deswegen der Rekurs auf das Vorbild der banī ’isrā’īla, der „Kinder Israels“, vgl. o.) ist zu festigen und darf nicht geschwächt werden. Den Angehörigen der Glaubensgemeinschaft werde deshalb in anderen Koranversen verordnet, im Fall eines unbeabsichtigten Tötungsdeliktes oder durch Erlassen der Schuld von der Vergeltung durch Blutrache (als Vollzug der „Talio“; vgl. Sure 2, 178 f.194; 5, 45; 25, 68; 28, 19) abzusehen und untereinander einen friedlichen Ausgleich durch Verzeihung und / oder die Regelung von Entschädigungszahlungen zu leisten (vgl. Nagel, ebd., S. 402; Asad, Die Botschaft des Koran, S. 70, Anm. 148).
3) Die Exegese Tilman Nagels zu Sure 5, 32 führt schließlich für das islamische Umfeld auch hier zu der Frage zurück, ob man den ethischen Anspruch der Sentenz als nur auf die muslimische Solidargemeinschaft eingeschränkt verstanden hat. Die Antwort, die die Überlieferung der Sentenz in den Erzählungen von 1001 Nacht gibt, ist eindeutig. Auch dort, im islamischen Umfeld, hat man an der universalen Gültigkeit ihrer Ethik festgehalten. In der „Geschichte vom Wolf und vom Fuchs“ (148.-150. Nacht) kommt die universale Geltung gleich durch zwei Merkmale zum Ausdruck. Zum einen wird die Sentenz / Formel ins Tierreich verlegt, zum anderen fehlt jeder Hinweis auf eine Heilige Schrift und damit auch auf eine bestimmte Glaubensgemeinschaft. Die erste Sentenzhälfte fehlt, die in der jüdischen Tradition und im Koran an die Geschichte von Kain und Abel anknüpfend, von der Tötung spricht. Die Doppelstruktur wird dann dadurch wiederhergestellt, dass die Bedeutung, die der Einzelne mit seinem rettenden Tun hat, durch die erste Hälfte noch mehr hervorgehoben wird; vgl. Enno Littmann, Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten, Bd. II, S. 256 f:
„Wisse, wer eine Seele aus dem Verderben errettet, der erhält sie am Leben; und wenn einer nur eine einzige Seele am Leben erhält, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit am Leben erhalten.“
LITERATUR:
Muhammad ASAD: Die Botschaft des Koran, Kairiner Text, Übersetzung und Kommentar, Patmos (Unternehmensgruppe Schwabenverlag, Ostfildern), 3. Auflage, Düsseldorf 2013.
Hartmut BOBZIN: Der Koran – neu übertragen, C.H. Beck, München 2010.
Otto EISSFELDT: Liber Genesis, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Faszikel 1, Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1969.
Georgii Wilhelmi FREYTAG: Lexicon Arabico-Latinum, Tom. III, Librairie du Liban, Beirut 1975.
Raphael Jacob FÜRSTENTHAL: Israels Gebete für Wochen-, Sabbath- und Festtage nebst den Pirke Aboth, neueste vollständige Ausgabe, Verlag der Buchhandlung Wolf Pascheles, Prag 1877.
Gillis GERLEMAN: Esther, Biblischer Kommentar Altes Testament, Bd. XXI, 2. Auflage, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1982.
Lazarus GOLDSCHMIDT: El Koran, das heißt Die Lesung, Nachdruck von Berlin, 1920, im Komet Verlag, Köln 2008.
Emanuel bin GORION: Geschichten aus dem Talmud, Insel Verlag, Frankfurt a.M., 1966.
Heinrich W. GUGGENHEIMER: Jerusalem Talmud – Tractates Sanhedrin, Makkot, and Horaiot, Studia Judaica, Bd. 51, W. de Gruyter, Berlin 2010.
Adel Theodor KHOURY / Muhammad Salim Abdullah: Der Koran, GTB-Sachbuch 783, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh 1987.
Enno LITTMANN: Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten, vollständige deutsche Ausgabe in sechs Bänden, Band II, Insel Verlag, Wiesbaden 1953.
MISCHNAJOT– Die sechs Ordnungen der Mischna – Hebräischer Text mit Punktation, deutscher Übersetzung und Erklärung, Victor Goldschmidt-Verlag, Basel, dritte Auflage, 1968.
Tilman NAGEL: Mohammed – Leben und Legende, R. Oldenbourg Verlag, München 2008.
Rudi PARET: Der Koran – Übersetzung, zehnte Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 2007.
Rudi PARET: Der Koran – Kommentar und Konkordanz, siebente Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1980.
Heinrich SPEYER: Die biblischen Erzählungen im Qoran, Georg Olms Verlag, Hildesheim / New York 1971.
Ludwig ULLMANN / L.W. WINTER: Der Koran – Das heilige Buch des Islam, Goldmann-Taschenbuch 7904, München 1959.
Zum Autor:
Friedrich Erich Dobberahn, geb. 28.03.1950 in Düsseldorf, ist promovierter Orientalist und Theologe. Er amtierte 1983-1985 und 1993-1997 als ev. Gemeindepfarrer in Wuppertal. 1985-1993 lehrte er als Professor Catedratico für Altes Testament und Semitische Sprachen an der Escola Superior de Teologia in Sao Leopoldo-RS, Brasilien, und hatte von 1997-2015 auch in Deutschland an verschiedenen Hochschulen Dozenturen für Altes Testament, Islamkunde und Allgemeine Religionswissenschaft inne. 2002-2006 war er ordentliches Mitglied der Theologischen Kammer der EKD-Gliedkirche Braunschweig und war an der Abfassung mehrerer Gutachten für die Landessynode maßgeblich beteiligt. Im Bologna-Verbund gehörte er 2002-2006 als Recognized Lecturer der University of Birmingham-UK und der Misjonshoegskolen in Stavanger-NO an. Er gab 1997 das Mashafa Genzat der äthiopischen Nationalliturgie heraus (Text, Übersetzung und Kommentar, in: Pietas Liturgica 9/10) und publizierte ab 1986 in Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch zahlreiche Aufsätze zu seinen Forschungsgebieten (Themen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, der Soziologie des Alten Testaments, sowie des Islamismus und der „Saarbrückener Schule“). 2021 veröffentlichte er bei Vandenhoeck & Ruprecht (Brill-Deutschland) sein Buch „Deutsche Theologie im Dienste der Kriegspropaganda – Umdeutung von Bibel, Gesangbuch und Liturgie 1914-1918“, das bereits 2022 in zweiter Auflage erschienen ist. In der Reihe „Kirche und Weltkrieg“ liegt von ihm vor: Kontroverse um ein Anti-Kriegs-Buch – Die Sprachverbrechen der Theologie 1914-1918 und die klerikale Sackgasse einer Rezension, 2023 (ISBN-13: 9783757889296).
Abbildung oben:
Ehemalige Jeschiwa von Waloschyn (commons.wikimedia.org);
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Jeschiwa_von_Waloschyn
